Mit dem Siegeszug des Internets in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren entwickelte sich auch das Phänomen der Plattformökonomie: Giganten wie Amazon, Google, Twitter, Uber oder AirBnB sind nur einige der erfolgreichsten Vertreter dieser Entwicklung. Um den Erfolg von Plattformen beschreiben zu können, wird häufig Metcalfe’s Law herangezogen, denn dieses Gesetz gilt auch für den Netzwerkeffekt, den die digitale Vernetzung mit sich bringt. Es liefert einen Ansatz, um eine Plattform zu bewerten: Demnach entspricht der Wert einer Plattform proportional der Zahl der Nutzer im Quadrat, wohingegen die Kosten nur linear zur Zahl der Teilnehmer steigen. Der Grund dafür sind die im Netzwerk herrschenden Austauschmöglichkeiten zwischen allen Nutzern. Ein Netzwerk mit 50 Nutzern hat dank der Interaktion beispielsweise einen Wert von 2.500, aber nur Kosten von 50. Dies bedeutet: Je mehr Kunden ein Angebot nutzen, desto stärker steigt der Wert, während die Kosten für den Betrieb nur linear wachsen.
Das Erbe analoger Vergangenheit: Hierarchische Organisationsstrukturen
Diesen Erfolg zu wiederholen fällt etablierten Unternehmen oftmals schwer. Zwar gibt es längst kein Unternehmen mehr, das nicht in irgendeiner Weise auf digitale Möglichkeiten setzt: Kundenanfragen werden seit geraumer Zeit per E-Mail beantwortet, eine gut gepflegte Website ist die beste Visitenkarte, ein Chatbot beantwortet erste Kundenanfragen, und es werden Online-Werbeanzeigen geschaltet. Dennoch haben sich die zu Grunde liegenden Organisationsstrukturen und das Geschäftsmodell meist seit langer Zeit nur wenig verändert.
Unternehmen, die noch im analogen Zeitalter gegründet wurden, verfügen über eine Vielzahl an Organisationseinheiten, die selbständig und in sich geschlossen an den Produktions- und Verkaufsabläufen mitwirken. Die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen folgt einem hierarchischen Muster und oftmals in recht starrer Art, wenn profitable Strukturen geschaffen wurden. Der gesamte Ablauf ist nicht für jede einzelne Abteilung sichtbar, sie kümmert sich lediglich um den für sie relevanten Teil des Prozesses. Damit eine Abteilung ihre Arbeit aufnehmen kann, müssen übergeordnete Abteilungen ihre Arbeit daran abgeschlossen haben. Gibt es Unklarheiten zum Bearbeitungsstatus kann dies unter Umständen den Bearbeitungsprozess verzögern. Zum Beispiel könnten in einer Versicherung in der Abteilung Schadensregulierung weitere Nachfragen zu einem eingereichten Fall auftauchen. Die Sachbearbeiter benötigen zusätzliche Dokumente, um den Fall korrekt einordnen zu können und müssen sich dafür an den zuständigen Kundenbetreuer wenden. Dieser wiederum muss erneut Kontakt zum Kunden aufnehmen. Erst nachdem letzterer die erforderlichen Dokumente nachgereicht hat, der Kundenbetreuer diese geprüft und anschließend an die Abteilung weitergegeben hat, kann die Schadensregulierung den Fall weiter bearbeiten. Derartige Top-Down-Prozesse sind noch in zahlreichen Unternehmen zu finden. In einer Zeit, in der Akten noch physisch von Abteilung zu Abteilung transportiert und bearbeitet werden mussten, war dies tatsächlich eine sinnvolle Struktur. Durch die Zuweisung einer Bearbeitungskette mit festen Zuständigkeiten einzelner Abteilungen konnten Abläufe standardisiert und die Fehleranfälligkeit gering gehalten werden. Zudem konnten diese fest definierten Prozesse optimiert werden, indem zum Beispiel gezielt Engpässe im Prozess beseitigt wurden.
„Schein-Digitalisierung“ gegen hohe Kundenansprüche
Zahlreiche Unternehmen befinden sich derzeit in einem Zustand, den man „Schein-Digitalisierung“ nennen könnte: Die Belegschaft nutzt digitale Kommunikationswege und auch das Kundenmanagement scheint sich mit CRM-Systemen spürbar verschlankt zu haben. Dahinter wirken allerdings meist noch hierarchische Organisationsstrukturen, es werden also bestehende Prozesse mit neuen digitalen Methoden ausgeführt. Das kann durchaus erfolgreich sein, ist aber kein Neudenken des Geschäftsmodells in der Art und Weise, wie digitale Technologien bestehende Prozesse komplett revolutionieren können.
Demgegenüber stehen jedoch die hohen Erwartungen der Kunden. Die Schnelligkeit, die direkte digitale Interaktionsmöglichkeiten über E-Mail, persönliche Accountbereiche oder gar Messenger erahnen lassen, erwarten Kunden auch in der Abwicklung ihrer Anliegen. Erfolgt dies nicht zu ihrer Zufriedenheit, neigen sie eher dazu, künftig Angebote von anderen Unternehmen zu nutzen, die sie besser in ihrer Customer Journey unterstützen und ihnen einen entsprechend schnellen Service bieten.
Keine Frage, der Standard, den die großen Wettbewerber in Sachen Kundenerwartungen prägen, setzt Unternehmen unter massiven Druck, ihre digitale Transformation voranzutreiben. Wie sich zeigt, ist diese mit der digitalen Unterstützung bestehender Abläufe aber keineswegs vollzogen. Auf Dauer ist diese Art der Zweigleisigkeit – hierarchische Strukturen mit teilweise digitalen Prozessen – schlichtweg zu teuer und kaum wettbewerbsfähig. Um die Erwartungen der Kunden an nahtlose, zuverlässige Interaktionsmöglichkeiten mit Produkt- und Serviceanbietern erfüllen zu können, benötigen Unternehmen nicht nur die entsprechenden IT-Kapazitäten, sondern eine Organisationsstruktur, die leistungsfähig genug ist, sich voll und ganz in den Dienst des Kundenerlebnisses zu stellen, und die Bereitschaft, das Geschäftsmodell kontinuierlich neuen Herausforderungen und Möglichkeiten anzupassen. Dabei muss man klarstellen: Nicht jedes Unternehmen hat das Zeug dazu, sich zu einer derart erfolgreichen Plattform wie Amazon zu entwickeln. Während manche noch zögern, sammeln die großen Player weiterhin viele Nutzer ein. Da unterdessen jeder Versuch in diese Richtung immer kostspieliger wird, kann es nicht für alle Unternehmen der optimale Zukunftsplan sein, ebenfalls zu einer Plattform zu werden. Es gibt dennoch zahlreiche Möglichkeiten für sie, ihr Geschäftsmodell für das digitale Zeitalter fit zu machen und sich gegebenenfalls in Nischen zu einer bedeutenden Größe zu entwickeln. Der Weg dorthin führt über die Öffnung ihrer IT-Systeme.
Prozessorientiertes Denken: Der erste Schritt in Richtung Plattform
Unternehmen stehen also vor der Herausforderung, zukunftssicher ihre Organisationsstrukturen neu auszurichten, entsprechende technische Kapazitäten aufzubauen, all das möglichst kosteneffizient umzusetzen und ihr Geschäftsmodell flexibler zu handhaben als zuvor. Die Veränderung, die vollzogen werden muss, ist tiefgreifend, reicht weit in die Zukunft und muss auf zahlreichen Ebenen durchgeführt werden. Das geflügelte Wort aus dem Komplexitätsmanagement trifft hier gut zu: „Wie isst man einen Elefanten?“ Antwort: „Stück für Stück.“ Aber dennoch: Wo soll man bloß anfangen? Zunächst kann es helfen, mit einer prozessorientierten Sichtweise alle Abläufe im Unternehmen vollkommen neu zu bewerten. Dies sollte unter dem Aspekt einer bestimmten, fundierten Zielsetzung erfolgen, beispielsweise mehr Kundenzentrierung, transparentere oder schnellere Abläufe. Wichtig ist dabei, unabhängig von zugewiesenen Bearbeitungskompetenzen zu denken. Entscheidend ist ausschließlich, wodurch ein einzelner Prozess optimiert werden kann.
Als weiterer Schritt ist es dann notwendig, über bestehende Prozesse hinauszudenken und zu identifizieren, in welcher Weise Produkte und Dienste besser von den Möglichkeiten digitaler Technologien profitieren können. Welche dieser Kandidaten sind dann einfacher umzusetzen und welche eher weniger? Hier kann sich oft schon zeigen, wo bestehender oder potentieller Wert zu sehr in bestehenden Prozessen und Systemen “gefangen“ ist, und wo es daher gilt, einen offeneren Ansatz zu verfolgen.
Organisatorische Prozesse digital abgebildet: Der Zugang zu Daten
Im digitalen Zeitalter ist die Verfügbarkeit von Daten und Diensten Dreh- und Angelpunkt für den Geschäftserfolg von Unternehmen. Von Services und Produkten erwarten Kunden digitale Zugriffsmöglichkeiten und Verfügbarkeit rund um die Uhr. Um die dafür organisatorischen, prozessorientierten Veränderungen auch auf IT-Ebene abbilden zu können, ist eine Öffnung sämtlicher IT-Systeme erforderlich. Geschlossene Silos müssen geöffnet und so verwaltet werden, dass sie allen Prozessen zur Verfügung stehen. Dieses neu geschaffene Ökosystem können Unternehmen nun nach ihren Vorstellungen gestalten und kanalisieren, und es kann von allen Teams und Geschäftsbereichen genutzt werden.
Erforderlich für die Schaffung und Weiterentwicklung von digitalen Ökosystemen sind APIs (Application Programming Interfaces). Sie ermöglichen Anwendungen Zugriff auf andere Dienste und Daten und sind damit die grundlegenden Bausteine der digitalen Transformation. Mit ihnen können Unternehmen ihre Informationssysteme vereinfachen: Funktionalitäten verschiedener Anwendungen können den Mitarbeitern unabhängig und einzeln in Form von Microservices zur Verfügung gestellt werden. APIs erlauben auch die Anbindung externer Prozesse und können der Belegschaft so die Kollaboration erleichtern. Unternehmen können damit ihre internen Prozesse effizienter gestalten und sind deutlich agiler. Haben Unternehmen diese technische Hürde bereits genommen, können sie darüber nachdenken, APIs zur Interaktion mit ihren Partnern einzusetzen. Beispielsweise können sie ihre Services Partnern und Entwicklern für die Integration in ihre Informationssysteme über APIs bereitstellen. Indem andere Anbieter die Services anbinden und wiederum ihren Kunden anbieten, können Unternehmen zusätzliche Einnahmequellen generieren. Stellen Unternehmen ihre Services im großen Stil zur Verfügung und können sie mit diesem Konzept eine große Nutzerschaft auf sich vereinen, weil sie ein Modell gemeinsamer Wertschöpfung mit ihren Partnern entwickelt haben, dann haben sie die Wandlung zum Plattform Business vollzogen.
Perspektive: Unternehmen als Service-Aggregatoren
Angesichts der Tragweite ist es durchaus verständlich, dass Unternehmen zögern, digitale Transformationsprozesse voranzutreiben. Es geht dabei keineswegs nur um die Implementierung leistungsfähiger IT-Systeme. Vielmehr stellt es den Kern eines Unternehmens grundsätzlich in Frage. Doch aus den Entwicklungen der Plattformökonomie lässt sich bereits ableiten, dass Unternehmen in Zukunft als Service-Aggregatoren agieren werden: Sie besitzen eigens entwickelte Produkte oder Dienste, welche jedoch nur noch wenig Raum in ihrem Portfolio einnehmen. Den Großteil werden zugekaufte oder von Partnern angebundene Services darstellen. Aus diesem Mix aus proprietären und mitgenutzten Technologien erschaffen Unternehmen Leistungen mit Mehrwert für ihre Kunden. Eine Vision, die derzeit noch die Vorstellungskraft und Planungsfähigkeit mancher Unternehmen übersteigt. Große Veränderungen beginnen allerdings immer mit einem kleinen Schritt. Die Öffnung für diesen Wandel ist ein essentieller Schritt in diese Richtung.
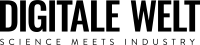


Um einen Kommentar zu hinterlassen müssen sie Autor sein, oder mit Ihrem LinkedIn Account eingeloggt sein.