Hybride Architekturen für die Zukunft des Computing
Generative KI, Quantencomputing und Hybrid Cloud wachsen zusammen – und eröffnen laut Juan Bernabé-Moreno neue Horizonte für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft
Künstliche Intelligenz, Quantencomputing und hybride Cloud-Infrastrukturen verändern derzeit das Fundament des Rechnens. Das hat große Auswirkungen auf unser Verständnis und unseren Einsatz von Technologie. Für Juan Bernabé-Moreno, Direktor von IBM Research Europe in Irland und dem Vereinigten Königreich, geht es insgesamt nicht nur um technologische Innovation, sondern um die Verzahnung dieser Entwicklungen mit ihren gesamtgesellschaftlichen Veränderungspotentialen. Im Gespräch erläutert er, warum die Kombination von KI, Quantencomputing und Hochleistungsrechnern ein neues Forschungsökosystem schafft, welche Anwendungen schon in Sicht sind und welche Verantwortung Unternehmen und Gesellschaft tragen, um diesen Wandel sinnvoll zu gestalten.
Was hat Sie persönlich zuletzt technologisch begeistert oder inspiriert?
Bernabé-Moreno: Für mich gibt es zwei Schlüsseltechnologien, die unser Leben grundlegend verändern. Die erste ist ganz klar generative KI. Es ist beeindruckend, wie viel Wissen und Intelligenz wir in KI-Modelle eingebracht haben, und gleichzeitig erschreckend, wie wenig wir als Gesellschaft vorbereitet sind, mit diesen mächtigen Werkzeugen umzugehen oder ihre Risiken richtig zu verstehen. Die zweite Technologie ist das Quantencomputing. Vor weniger als zehn Jahren stritt die Wissenschaft noch darüber, ob ein verlässlicher Quantencomputer überhaupt möglich ist. Heute arbeiten alle IBM-Quantencomputer auf einem wissenschaftlich nützlichen „Utility Scale“. Das heißt, sie führen Schaltkreise aus, die so groß und komplex sind, dass klassische Computer sie nur noch näherungsweise simulieren können. Wir sind überzeugt, dass 2026 die erste Anwendung mit echtem „Quantum Advantage“ erreicht wird (also dann, wenn ein Quantencomputer eine Aufgabe genauer, günstiger oder effizienter lösen kann als ein klassischer Computer). Für 2029 haben wir uns zudem das Ziel gesetzt, den ersten großen, fehlertoleranten Quantencomputer zu bauen, der in der Lage sein wird, Algorithmen und Anwendungen auszuführen, die unsere Gesellschaft auf völlig neue Weise verändern.
Was wird das Aufkommen dieser Technologien weiter begünstigen?
Bernabé-Moreno: Besonders begeistert mich die Wiedergeburt der algorithmischen Forschung. Künstliche Intelligenz, klassische Hochleistungsrechner und Quantencomputer wachsen endlich zu einem einheitlichen Ökosystem zusammen. IBM spielt hier mit dem AI–Quantum Link eine Vorreiterrolle: Unsere Software-Stack, darunter der Qiskit Code Assistant, unterstützt durch unsere Granite-Modelle, erleichtert es Nutzerinnen und Nutzern, neue Algorithmen zu entwickeln, die die Komplexität und Relevanz von Quantenanwendungen steigern. Mit zunehmender Rechenleistung der Quantencomputer werden sie in der Lage sein, extrem komplexe Datensätze zu verarbeiten, und so auch KI-Anwendungen beschleunigen, die auf das Erkennen hochdichter Muster angewiesen sind, etwa beim Training großer Sprachmodelle.
KI wird damit nicht nur eine Anwendungsschicht sein, sondern der Orchestrator, der entscheidet, wann klassische Methoden und wann Quantenbeschleunigung genutzt werden.
Diese Fusion eröffnet Algorithmen, die riesige Lösungsräume erkunden, komplexe Systeme simulieren und Erkenntnisse in einem Tempo und Maßstab liefern, das bisher unvorstellbar war. So entsteht eine neue Dynamik in Bereichen wie Arzneimittelforschung, Materialwissenschaft, Logistik oder Finanzwesen. Kurz gesagt: Dieses „Renaissance-Moment“ entsteht nicht durch einzelne Technologien, sondern durch ihre enge Integration, die die algorithmische Forschung selbst verändert.
Was genau trägt IBM in dieser Entwicklung bei?
Bernabé-Moreno: Bei IBM Research beschleunigen wir die Entwicklung neuer Algorithmen gezielt für eine Welt, die durch KI und Quantencomputing geprägt sein wird. Das Fundament des Rechnens verschiebt sich schneller als je zuvor. Klassische Hochleistungsmaschinen tragen weiterhin die Hauptlast von Simulationen und Analysen, KI-Modelle verdichten unstrukturierte Daten in aussagekräftige Repräsentationen, und Quantenprozessoren beginnen, Informationen jenseits der Möglichkeiten klassischer Bits zu verarbeiten. Diese Konvergenz schafft neue mathematische Grundlagen – von Differentialgleichungen über kombinatorische Optimierung und lineare Algebra bis hin zu stochastischen Prozessen – die Innovationen in Bereichen wie Aerodynamik, Flottenoptimierung, Energiespeicher oder Marktmodellierung ermöglichen.
Dieses Jahr dreht sich die DIGICON um das Thema „REINVENT your Business and Life“. Wie gehen Sie mit dem Begriff „Reinvention“ beruflich um?
Bernabé-Moreno: Reinvention oder generell Neuerfindung ist ein ständiger Begleiter in der Forschung. Jeden Tag stehen wir auf mit der Frage: „Was kommt als Nächstes im Computing?“ Und wir treiben die Grenzen von Wissenschaft und Technik voran, um die Zukunft der Technologie zu gestalten. Fortschritte in einem Bereich können dabei ganze andere Felder umwälzen und neu erfinden. Ein gutes Beispiel ist die Transformer-Architektur. Sie entstand ursprünglich für Sprache, doch NASA und IBM haben die Idee der Vision Transformer auf Erdbeobachtungsdaten von Satelliten angewandt – und plötzlich wurde die Geodatenanalyse neu erfunden.
Ich bin überzeugt, dass Quantencomputing und KI sich gegenseitig neu erfinden werden. Wir sehen gerade die ersten Anzeichen dieser gegenseitigen Verstärkung, und ich freue mich sehr darauf, was als Nächstes kommt.
Welche Rolle spielen künstliche Intelligenz und Datenökonomie bei dieser „Reinvention“ aus Ihrer Sicht – heute und in den nächsten 5–10 Jahren?
Bernabé-Moreno: Für mich bedeutet „Reinvention“ mehr als schrittweise Innovation. Es geht darum, Organisationen, Branchen und sogar Gesellschaften von Grund auf neu zu gestalten, nicht nur Dinge schneller oder billiger zu machen, sondern neu zu definieren, was möglich und wertvoll ist. Künstliche Intelligenz ist der Motor dieses Wandels. Heute automatisiert und unterstützt sie Entscheidungen.
In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird Künstliche Intelligenz ein echter Partner für Kreativität und Entdeckung sein und die Grenzen dessen verschieben, was wir Menschen allein erreichen können.
Die Datenökonomie ist das Fundament. Daten sind der Treibstoff für KI. Organisationen, die sie teilen, anreichern und verantwortungsvoll steuern können, werden den größten Mehrwert freisetzen. Gleichzeitig verändert KI auch unseren Blick auf Daten. Ein entscheidender Beschleuniger ist die KI-gestützte Generierung synthetischer Daten. Wenn Datenschutz, Knappheit oder Kosten zum Engpass werden, können synthetische Daten seltene Ereignisse simulieren, Trainingsmengen erweitern und Lücken in realen Beobachtungen schließen. Für Bereiche wie Gesundheitswesen, Klimaforschung oder autonome Systeme eröffnet das Möglichkeiten, die mit Rohdaten allein unerreichbar wären. So entstehen KI-Modelle, die robuster, fairer und allgemeiner anwendbar sind.
Gleichzeitig müssen wir wachsam bleiben gegenüber dem Risiko einer „Daten-Kannibalisierung“. Wenn KI-Modelle überwiegend mit von anderen Modellen erzeugten Daten trainiert werden, kann die Qualität und Vielfalt der Erkenntnisse leiden. Diese Schleife verstärkt Vorurteile, drückt Kreativität zusammen und entfernt die Ergebnisse von der realen Welt, die sie eigentlich abbilden sollen. In einer gesunden Datenökonomie ergänzen synthetische Daten die realen Signale – sie ersetzen sie nicht. Nur so bleibt die Reinvention in der Realität verankert.
IBM spricht oft von „AI for Business“. Wo sehen Sie derzeit den größten Hebel für Unternehmen, durch KI tatsächlich Mehrwert zu schaffen – jenseits des Buzzwords?
Bernabé-Moreno: Aus IBM-Sicht bedeutet „AI for Business“, den Hype zu durchschneiden und sich darauf zu konzentrieren, wo KI heute messbaren Nutzen bringt. Der größte Hebel liegt nicht in fernen Zukunftsvisionen, sondern darin, KI in die Kernprozesse einzubetten, die Effizienz, Entscheidungsqualität und Kundenerlebnis verbessern.
Drei Bereiche stechen hervor. Erstens die Automatisierung von Geschäftsabläufen, KI optimiert Prozesse, reduziert manuelle Arbeit und schafft Freiräume für wertschöpfende Aufgaben. Zweitens KI-gestützte Erkenntnisse, sie helfen Unternehmen, schneller und besser zu entscheiden, indem sie Muster in Daten sichtbar machen, die bisher verborgen waren. Drittens Vertrauen und Governance – Transparenz, Fairness und Sicherheit sind entscheidend, damit Unternehmen KI verantwortungsvoll und im großen Maßstab einsetzen können.
Hier hat IBM eine besondere Stärke: Wir verbinden modernste KI-Modelle mit tiefem Branchenwissen und einem offenen, hybriden Cloud-Ansatz. So bringen wir KI nicht nur in Labore oder Prototypen, sondern auch in regulierte Branchen wie Finanzwesen, Gesundheitswesen und Industrie, wo Zuverlässigkeit und Compliance unerlässlich sind.
Am Ende liegt der größte Wert von KI nicht darin, ein Schlagwort zu sein, sondern ein vertrauenswürdiges Werkzeug: ein System, das Unternehmen hilft, ihre Arbeit neu zu gestalten, schneller zu innovieren und im dynamischen Wettbewerb die Nase vorn zu behalten.
Welche Technologien (z. B. generative KI, hybride Cloud, Quantumcomputing) werden Ihrer Meinung nach die größten „Game Changer“ in den nächsten Jahren sein – und warum?
Bernabé-Moreno: Hybrid Cloud begleitet uns seit über zehn Jahren, doch ihre Bedeutung verändert sich. Sie bildet heute das Rückgrat für unternehmensreife KI-Anwendungen. Sie ermöglicht es, Workloads über verschiedene Umgebungen hinweg, ob öffentlich, privat oder lokal, auszuführen, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Compliance. Das ist entscheidend, um KI verantwortungsvoll zu skalieren und sie dort einzusetzen, wo die Daten liegen.
Da Daten immer wichtiger werden und Unternehmen beginnen, eigene KI-Modelle zu entwickeln, setzen sich hybride Architekturen mit einem starken On-Premises-Anteil zunehmend durch. Öffentliche Clouds verschwinden nicht, doch für den großflächigen Einsatz eigener KI stoßen sie an Grenzen. Allein auf Public Clouds zu setzen, kann zudem wirtschaftlich hinderlich sein.
Unser Fokus liegt darauf, KI nicht als Hype, sondern als echten Geschäftsvorteil einzusetzen. Dabei geht es um spezialisierte, verlässliche Modelle für konkrete Unternehmensanwendungen, nicht um riesige, generische Foundation Models. Mit Plattformen wie watsonx ermöglichen wir es Firmen, KI auf Basis eigener Daten zu trainieren, zu steuern und sicher einzusetzen – mit voller Kontrolle über Sicherheit und Compliance und maßgeschneiderter Intelligenz für ihr Geschäft. KI ist schon heute ein echter Game Changer, sei es durch Produktivitätssteigerung oder durch die Eröffnung völlig neuer Geschäftsmodelle.
Und wie sieht das im Bereich des Quantencomputing aus?
Bernabé-Moreno: Auch im Quantencomputing schreiten wir schnell voran: von der reinen Nützlichkeit hin zu konkreten Anwendungen mit klarem Branchenvorteil. IBMs Roadmap zeigt die kommende Ära des quantum-zentrischen Supercomputings, in der Quantenmaschinen mit klassischen Hochleistungssystemen verschmelzen. Durch Partnerschaften wie mit AMD verfolgen wir ein klares Ziel: hybride Infrastrukturen, die Probleme lösen, die klassische Systeme allein nicht bewältigen können. Besonders spannend ist, dass Quantum nun greifbar ist. Unser Ziel: 2026 den „Quantum Advantage“ demonstrieren – also eine Aufgabe nachweislich schneller, genauer oder günstiger zu lösen als rein klassisch.
Am meisten begeistert mich jedoch das Zusammenspiel dieser drei Technologien. Der wahre Umbruch liegt in ihrer Konvergenz: Generative KI liefert neue Intelligenz, Hybrid Cloud bietet die sichere und skalierbare Plattform, und Quantum Computing öffnet den Weg zu Lösungen für bisher unlösbare Probleme. Diese Zukunft ist nicht fern – wir sehen die ersten Anzeichen bereits heute in Bereichen wie Materialforschung, Lieferkettenoptimierung oder Klimamodellierung, wo das Zusammenspiel von KI, Cloud und Quantum die Grenzen des Machbaren neu definiert.
Wie verändern sich durch diese Technologien ganze Branchen – zum Beispiel Energie, Gesundheit oder Fertigung? Können Sie ein Beispiel geben?
Bernabé-Moreno: Ein Beispiel, das ich gut kenne, ist die Energiewelt.
Der Betrieb der Energieinfrastruktur erfordert laufend Entscheidungen unter großer Unsicherheit: die Volatilität erneuerbarer Energien, fehlende Daten, das Zusammenspiel tausender Akteure in Prosumer-Modellen – alles Quellen von Komplexität. Das Stromnetz selbst, das Rückgrat unserer Gesellschaft, bleibt eine der komplexesten Ingenieursleistungen der Menschheit. Mit Foundation Models für KI lassen sich viele dieser Systeme in großem Maßstab abbilden – ein entscheidender Schritt, um die wachsende Komplexität unseres Energiesystems zu bewältigen.
Gemeinsam mit der NASA haben wir Prithvi-WxC veröffentlicht, ein Foundation Model für Wetter und Klima. Es ermöglicht präzise Vorhersagen, das Herunterskalieren von Klimamodellen für langfristige Szenarien oder die Simulation geänderter Bedingungen, wie z.B. einer Erhöhung der Ozeanoberflächentemperatur um 0,5 Grad. Ebenfalls mit der NASA haben wir Prithvi-EO geschaffen, ein Erdbeobachtungsmodell, das auf Satellitenbildern basiert und Anwendungsfälle wie Landnutzungsänderungen, Vegetationsmanagement oder die Bewertung von Erdrutschen ermöglicht – wichtige Bausteine für die Resilienz kritischer Infrastrukturen wie Stromnetze. Dieses Jahr haben wir auch Surya veröffentlicht, das erste Foundation Model für die Sonne. Damit lassen sich Sonnenstürme und die Geschwindigkeit des Sonnenwinds mit bisher unerreichter Genauigkeit vorhersagen – beides entscheidend für den Schutz von Netztransformatoren.
Technologie ist das eine – aber wie muss sich das Mindset in Unternehmen ändern, damit wirkliche Transformation gelingt? Ist der CEO der Zukunft ein anderer als ein CEO heute? Warum und was muss ihn für die Zukunft auszeichnen?
Bernabé-Moreno: Technologie allein bewirkt keine Transformation. Entscheidend ist die Haltung. Der CEO der Zukunft muss Technologie nicht nur als Effizienz-Werkzeug sehen, sondern als Treiber echter „Reinvention“.
Führungskräfte von morgen brauchen digitale Souveränität, die Fähigkeit, über Ökosysteme hinweg zu arbeiten, und den Mut, Vertrauen und Transparenz ins Zentrum ihrer Strategie zu stellen. Sie müssen anpassungsfähig sein, schnell umschalten können und ihre Organisation dazu inspirieren, kontinuierlich zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Ein zentraler Punkt: CEOs müssen ihre eigene KI entwickeln, basierend auf ihren eigenen Daten, nur so können sie sich klar von Mitbewerbern abheben.
Ebenso wichtig ist ein „mutiges“ Mindset bei neuen Technologien wie Quantencomputing. Wer zögert, gibt den Wettbewerbern den Vorsprung als Early Adopter. Es reicht nicht, einfach eine API aufzurufen und schon ist das Unternehmen „quantum-ready“ oder vollständig in KI eingebunden. Dafür braucht es Vorbereitung von innen heraus, Investitionen und Rückendeckung von ganz oben, um von einzelnen Anwendungsfällen zu echter Transformation zu gelangen.
Der CEO der Zukunft ist nicht nur ein Business-Leader, sondern auch ein mutiger Technologie-Stratege und ein Hüter des Vertrauens. Das wird den Unterschied machen zwischen denen, die wirklich neu erfinden – und denen, die zurückfallen.
Wie gelingt der Balanceakt zwischen Innovation und Verantwortung – gerade bei Themen wie KI-Ethik, Datenmissbrauch oder Bias?
Bernabé-Moreno: Es darf nicht um ein Gegeneinander gehen! Innovation muss immer auch durch die Brille der Vertrauenswürdigkeit betrachtet werden. Der Möglichkeitsraum wächst rasant. Technologien, die vor ein bis zwei Jahren noch undenkbar waren, sind heute für viele Menschen direkt verfügbar.
Wir sind überwältigt vom Tempo des technologischen Fortschritts – und haben unsere Unternehmen noch nicht wirklich „neu erfunden“. Prozesse, Kultur und auch Regulierung können kaum Schritt halten. KI ist ohne Zweifel eine der transformativsten Technologien, die wir je geschaffen haben, und doch suchen wir noch Wege, diese Transformation im Einklang mit unseren Werten umzusetzen. Gleichzeitig sehen wir erste Anzeichen einer „Sättigung“, da immer mehr Daten von KI-Systemen selbst erzeugt werden.
Im Unterschied zu vielen anderen Technologien hat KI fast jede und jeden erreicht, der Zugang zu Computer oder Smartphone und Internet hat. Diese Massenadoption erfordert einen klaren Fokus auf Vertrauen im großen Maßstab. Für uns ist das Verhältnis von Innovation und Verantwortung kein Trade-off, sondern eine Grundbedingung. Innovation, gerade bei KI, kann nur skalieren, wenn sie auf Vertrauen basiert. Das bedeutet, Themen wie Ethik, Datenmissbrauch und Verzerrungen nicht nachträglich zu behandeln, sondern von Anfang an in Konzeption und Umsetzung einzubauen.
IBM spricht von „Responsible AI“. Wie kann man sicherstellen, dass technologische Fortschritte nicht nur Profit, sondern auch sozialen Mehrwert schaffen?
Bernabé-Moreno: Aus IBM-Sicht ist „Responsible AI“ kein Zusatz, sondern das Fundament dafür, wie KI entwickelt, eingesetzt und skaliert werden sollte. Der Grundsatz ist klar: Technologischer Fortschritt muss Geschäftswert schaffen, und zugleich Vertrauen und positiven gesellschaftlichen Nutzen bringen.
IBM war hier oft Vorreiter und einer der ersten Akteure. Schon 2017 haben wir als erstes großes Unternehmen Prinzipien für KI-Ethik veröffentlicht. Es folgten konkrete Werkzeuge: AI Fairness 360 (2018), Adversarial Robustness 360 (2018) und AI Explainability 360 (2019) – die ersten Open-Source-Toolkits ihrer Art. Alle sind frei zugänglich auf GitHub und durch Forschung untermauert, sodass Entwickler, Wissenschaftler und Regulierer sie nutzen, prüfen und verbessern können. Mit Open Source haben wir vertrauenswürdige KI von einem IBM-Ziel zu einer globalen Ressource gemacht.
Diesen Weg setzen wir fort: Unsere Granite-LLMs sind mit Apache 2.0 frei verfügbar, ebenso wie die Modelle, die wir mit Partnern wie der NASA entwickeln. Damit stärken wir die gesamte Community. 2023 haben wir gemeinsam mit Meta und über 50 weiteren Institutionen weltweit die AI Alliance gegründet, um offene KI-Agenten, Daten, Modelle, Evaluation, Sicherheit und Anwendungsfelder voranzubringen und sicherzustellen, dass alle profitieren.
Was heißt das im Konkreten?
Bernabé-Moreno: Um Fortschritt im Gleichgewicht von Profit und gesellschaftlichem Wert zu sichern, braucht es drei Dinge:
- Governance – KI-Systeme müssen transparent, erklärbar und überprüfbar sein.
- Fairness und Inklusion – Daten und Modelle müssen aktiv überwacht werden, um Verzerrungen zu reduzieren und Vielfalt widerzuspiegeln.
- Offene Zusammenarbeit – Regulierung, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Industrie müssen gemeinsam Rahmen schaffen, die KI mit menschlichen Werten verbinden.
Darum hat IBM verantwortungsvolle KI-Praktiken direkt in die eigene Technologie integriert. Mit watsonx.governance machen wir es möglich, Risiken im großen Maßstab zu überwachen, zu erklären und zu reduzieren – sodass KI nicht nur Profit schafft, sondern auch Vertrauen, Fairness und gesellschaftlichen Mehrwert.
Wir bauen nicht nur verantwortungsvolle KI für unsere Kunden, sondern befähigen durch Open Source auch die globale Community. Diese Kombination aus Vorreiterrolle, Governance by Design und Offenheit macht den IBM-Ansatz einzigartig.
Wie sehen Sie die Rolle von IBM als Enabler im europäischen Innovationsökosystem – z. B. im Kontext des AI Acts oder der digitalen Souveränität?
Bernabé-Moreno: Aus IBM-Sicht ist unsere Rolle im europäischen Innovationsökosystem die eines Enablers: Wir wollen vertrauenswürdige, offene Technologien fördern und unseren Partnern die Möglichkeit geben, Technologie nach ihren eigenen Bedingungen auszuwählen und aufzubauen. Europa prägt mit Initiativen wie dem AI Act die globale Debatte über die Entwicklung und Regulierung von KI. Seit langem setzen wir uns für eine präzise Regulierung ein, Regeln, die risikobasiert, klar und innovationsfördernd sind, während sie gleichzeitig die Rechte der Bürgerinnen und Bürger schützen.
Konkret heißt das: Wir arbeiten mit Politik, Wissenschaft und Industriepartnern zusammen, um sicherzustellen, dass KI-Systeme verantwortungsvoll in Europas stark regulierten Sektoren eingesetzt werden können.
Unsere Open-Source-Beiträge wie AI Fairness 360 und Explainability 360 unterstützen Organisationen dabei, Anforderungen an Transparenz, Fairness und Nachvollziehbarkeit zu erfüllen. Gleichzeitig stärken wir unsere Partner darin, ihre Innovationsziele zu erreichen, compliant zu bleiben und die Kontrolle über ihre Technologie zu behalten – oft als digitale Souveränität bezeichnet. Mit unserer Hybrid-Cloud- und KI-Plattform ermöglichen wir es Kunden, Daten dort zu halten, wo sie hingehören, über mehrere Umgebungen hinweg zu operieren und die volle Kontrolle über ihre sensibelsten Werte zu behalten. Diese Flexibilität ist entscheidend, um Innovation, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Wir sind überzeugt: Jedes Unternehmen sollte seine Technologie jederzeit weiterentwickeln oder anpassen können, ohne große Brüche oder Kompromisse.
Unsere Partnerschaften mit Unternehmen in Deutschland begannen vor Jahrzehnten, die Technologie hat sich verändert, doch das Engagement ist geblieben. Heute bringen wir Responsible AI, Open Innovation und sichere hybride Infrastrukturen zusammen, damit europäische Organisationen Technologie gestalten, die Wettbewerbsfähigkeit stärkt und den Gemeinschaften, denen sie dienen, zugutekommt.
Wenn Sie sich selbst in 10 Jahren als „re-invented human“ vorstellen müssten – was wäre dann anders?
Bernabé-Moreno: Wenn ich mich selbst in zehn Jahren als „re-invented human“ vorstelle, dann liegt der größte Unterschied darin, wie selbstverständlich ich mit Technologie lebe und arbeite. Heute sehen wir KI oft noch als Assistenten. In Zukunft sehe ich mich in einer wirklich symbiotischen Zusammenarbeit, in der menschliche Kreativität und maschinelle Intelligenz gemeinsam neue Entdeckungen vorantreiben.
Als „re-invented human“ müsste ich in komplexen Situationen die richtigen Entscheidungen treffen, und dafür auf vollständig vertrauenswürdige KI bauen: transparent, zuverlässig und an menschlichen Werten orientiert. Rechen-Workflows würden nahtlos von Quantencomputern und Hochleistungsrechnern unterstützt, mit KI als verbindender Plattform, die all diese Fähigkeiten orchestriert.
Neu erfunden zu sein bedeutet, das menschliche Potenzial durch vertrauensvolle, symbiotische Zusammenarbeit mit KI und Computersystemen zu erweitern, und dies auf einem Niveau, das heute noch kaum vorstellbar ist. In zehn Jahren wird der „re-invented human“ Technologie nicht nur nutzen, sondern in Symbiose mit ihr leben.








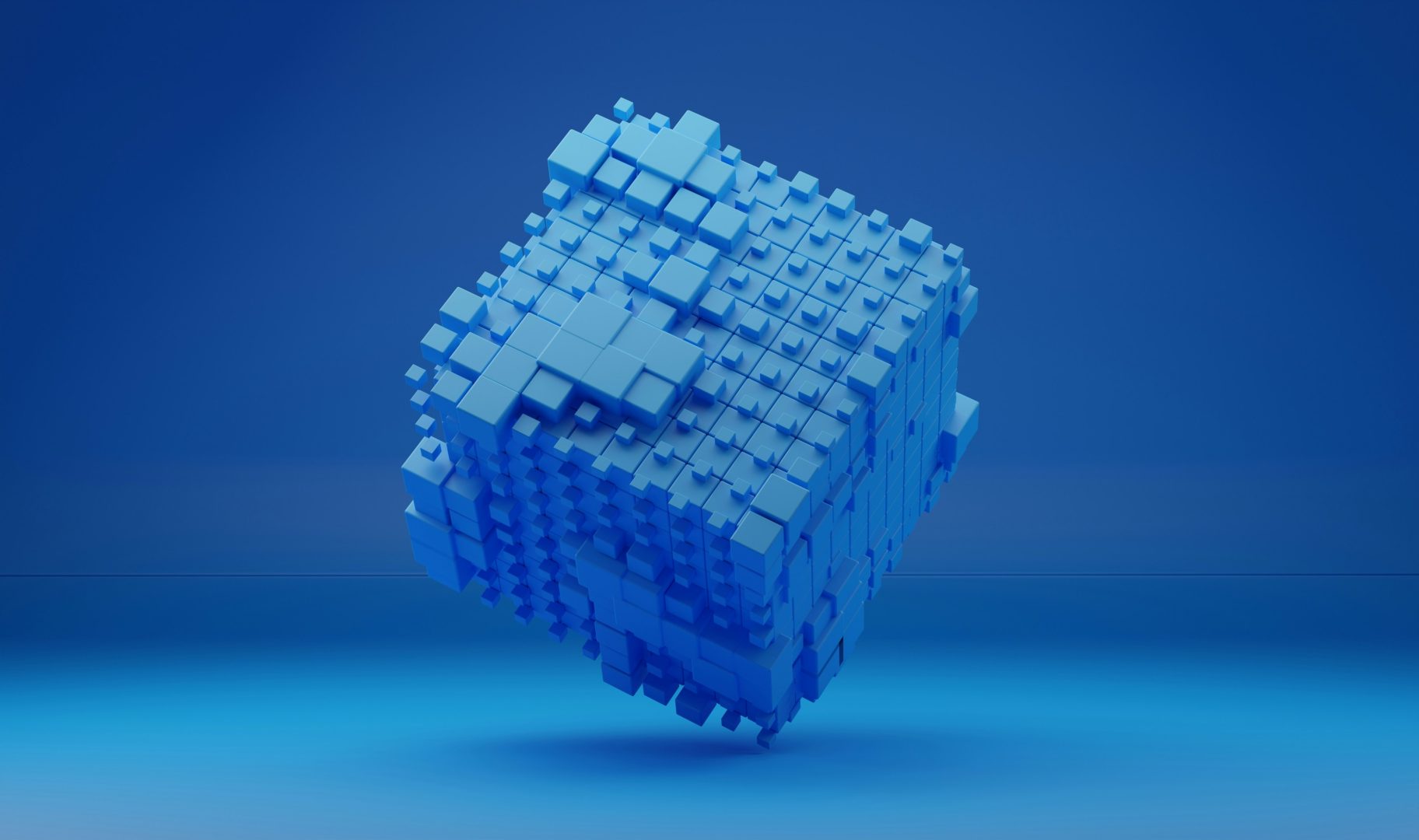


Um einen Kommentar zu hinterlassen müssen sie Autor sein, oder mit Ihrem LinkedIn Account eingeloggt sein.