Die oft angeführten Themen EU und der gesetzliche Datenschutz können somit nicht der eigentliche und einzige Bremsklotz sein. Es stellt sich daher die Frage, weshalb es eigentlich kaum Digitalisierung und digitalen Datenaustausch in Deutschland gibt? Die Antwort ist vielschichtig und hat mehrere Gründe. Die Probleme beginnen mit der föderalistischen Struktur der 16 Bundesländer. Gibt etwa der Bundesdatenschutzbeauftragte sein Okay zu einem Projekt oder einer Idee, so kann ein Landesdatenschutzbeauftragter dazu jederzeit sein Veto in diesem Bundesland einlegen. Gleiches gilt auch für Aufsichtsbehörden wie Regierungspräsidien und Amtsapotheker. Entspricht beispielsweise eine medizinisch-technische bzw. digitale Lösung der Bundesgesetzgebung, so ist die Auslegung wieder Ländersache.
Zu viele Interessengruppen und wenig Datenschutz
Anhand dieser Beispiele wird schnell klar: Es gibt im komplexen deutschen Gesundheitswesen zu viele Interessengruppen – und somit sehr partielle Interessen. Dabei werden der Datenschutz und die Datensicherheit gerne als Argument genutzt, um etwas zu verhindern oder zu bremsen. Die Politik wiederum trägt auch ihren Teil dazu bei. So wird die Digitalisierung zwar schon lange thematisiert – aber es passiert in der Praxis trotzdem kaum etwas oder es wird fast nichts konkret umgesetzt. Erschwerend hinzu kommt: Für viele Menschen in Deutschland reduziert sich das Verständnis von Digitalisierung auf die Erreichbarkeit mit dem Handy im letzten Winkel der Republik.
Beim Blick in die baltischen Staaten ergibt sich dagegen ein ganz anderes Bild. So erhält man in Estland ein Rezept in Form eines E-Rezepts auf das Handy, ohne vorher eine Arztpraxis betreten zu haben. Parkgebühren werden dort mit dem Mobiltelefon bezahlt, Verträge mit dem elektronischen Personalausweis am PC geschlossen, bei Parlamentswahlen wählen die Esten ohne Gang zum Wahllokal, ohne Wahlzettel und ohne Stift. Fakt ist: Mehr als 3000 Dienstleistungen von Behörden und Unternehmen können in Estland digital erledigt werden.
Gerade auch in Corona-Zeiten war und ist das ein riesiger Vorteil. Zum Vergleich: Zumindest im Electronic Banking gibt es in Deutschland seit vielen Jahren eine funktionierende digitale Lösung für äußerst sensible Daten. Auch das Bestellwesen im Internet funktioniert hierzulande durchaus – vorausgesetzt, man lässt sich nicht mit dubiosen Händlern ein. Ansonsten sieht es in Deutschland in Sachen Digitalisierung aber finster aus.
Deshalb muss die Frage aufgeworfen werden, wie ausgeprägt die Digitalisierung eigentlich im deutschen Gesundheitswesen ist, welche Vorteile sie mit sich bringt und was man darunter konkret versteht? Im Allgemeinen versteht man darunter in der Medizin- und Gesundheitsbranche die Umwandlung von analogen Daten und Vorgängen in eine digitale Form – oftmals auch digitale Transformation genannt. Sie sorgt für schlankere Prozesse, Kostensenkungen, Personaleinsparung, höhere Transparenz und mehr Flexibilität.

Demografischer Wandel erschwert Situation in der Pflege zusätzlich
Klar ist: Deutschland befindet sich demografisch in einer zunehmend dramatischen Situation. Bezogen auf das Gesundheitssystem bedeutet das: Fast 25 Millionen Menschen sind laut Erhebungen von Statista 60 Jahre oder älter, immer mehr Menschen wollen oder müssen länger zuhause leben. Laut „Ärzteblatt“ fehlen bereits heute mindestens 200.000 examinierte Pflegekräfte, der „Bertelsmann Pflegereport“ prognostiziert bis zum Jahr 2030 sogar 500.000 fehlende Fachkräfte.
Dabei kommt erschwerend hinzu, dass in einer überalternden Gesellschaft die Menschen immer älter werden und zwangsläufig die Krankheiten mit zunehmendem Alter auch zunehmen. Auch die moderne Medizin trägt zum Älterwerden bei. Bereits heute leben rund 3,4 Millionen Senioren – in wenigen Jahren werden es sogar sechs Millionen sein – mit einem Pflegegrad zuhause. Doch wer versorgt sie, wer kümmert sich?
Das sind zum einen die Pflegedienste. Eine der bedeutendsten Aufgaben eines ambulanten Pflegedienstes sind sämtliche körperbezogene Pflegemaßnahmen. Aktuell werden rund eine Million Senioren mit Pflegegrad durch einen der rund 15.000 ambulanten Pflegedienste in Deutschland zuhause mitversorgt. Laut Statista wurden im Jahr 2021 deutschlandweit 16.115 Pflegeheime und 15.376 ambulante Pflegedienste gezählt. Rund eine Million Menschen leben in Seniorenwohnheimen und wiederum eine Million Menschen werden zuhause durch einen ambulanten Pflegedienst betreut.
Die Probleme liegen in Anbetracht der skizzierten Zahlen und Fakten auf der Hand: Mangelnde Pflegekräfte, explodierende Kosten sowie die schnelle Zunahme älterer Menschen und damit einhergehend der Pflegebedürftigkeit. Gerne nimmt dabei der Staat die Hilfe der rund fünf Millionen pflegenden Angehörigen in Anspruch. Denn auch wenn der ambulante Pflegedienst kommt – um viele anfallende Aufgaben müssen sich die pflegenden Angehörigen kümmern. Und das oftmals auch über größere Entfernungen. Sie kümmern sich um Arztbesuche, Rezeptabholung, den Gang zur Apotheke, das Medikamente-Vorrichten, den Schriftverkehr, Einkäufe und viele weitere kleine Dinge des Alltags, die der Senior zunehmend weniger oder gar nicht mehr leisten kann.
Laut dem Branchenportal „Pflege-durch-Angehörige“ leisten fast fünf Millionen pflegende Angehörige Unterstützung oder übernehmen die Pflege komplett selbst. Davon sind 65 Prozent selbst berufstätig. Rund drei Viertel der Pflegenden belastet die Pflege stark oder sogar sehr stark. 70 Prozent der Angehörigen und Patienten sind überdies überfordert mit dem Vorrichten der Medikamente.

Digitalisierung bietet große Chancen
Am Beispiel der Medikamentenversorgung lassen sich sowohl die Probleme als auch die mit der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens einhergehenden Möglichkeiten und Chancen gut veranschaulichen und darstellen. Denn das Ganze beginnt mit dem Verstehen des Prozesses. So wird der Patient mit zunehmendem Alter nicht nur vom Hausarzt, sondern zunehmend auch von Fachärzten behandelt. Dabei werden in der Regel auch Medikamente verschrieben. Nimmt ein Mensch drei und mehr Medikamente parallel ein, spricht man von Polymedikation. Laut der Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände (ABDA) nehmen 28 Prozent der Menschen ab dem 50. Lebensjahr drei und mehr Medikamente dauerhaft. Mit zunehmendem Alter sind es oftmals acht, zehn und noch mehr. Im Seniorenwohnheim liegt der Schnitt bei elf Medikamenten.
Polymedikation ist in allen Ländern der Welt mit modernem Gesundheitssystem ein gravierendes Problem. Bezogen auf Deutschland bedeutet das, dass jeder Arzt und Facharzt seine fachspezifischen Medikamente kennt und verschreibt. Was die jeweiligen Kollegen verschrieben haben, weiß er jedoch nicht – und in der Regel der Patient auch nicht wirklich. Das hat Gründe: Eine zentrale patientenbezogene Medikamentendatei gibt es unter anderem aus Datenschutzaspekten nicht. Somit existiert auch kein schlüssiger und geprüfter Gesamtmedikationsplan. Die Wunschvorstellung im deutschen Gesundheitswesen ist, dass der Patient alle Rezepte und Verschreibungen zu seinem Hausarzt trägt und dieser sie anschließend prüft und den Gesamtmedikationsplan erstellt.
Die Realität sieht allerdings anders aus: Denn der Hausarzt hat weder die Zeit noch die pharmakologische Fachausbildung hierfür. Diese liegt dagegen klar bei der Apotheke, sie wäre im Prozess durch ihre pharmakologische und pharmazeutische Ausbildung die richtige Anlaufstelle. Oftmals kümmern sich die pflegenden Angehörigen um die Folgerezepte beim Arzt, tragen sie zur Apotheke, holen die Medikamente ab und richten sie in kleinen Pillenboxen für in der Regel sieben Tage vor.
Fehl- und Nichteinnahme von Medikamenten ist gravierendes Problem
All das ist extrem zeit- und personalaufwändig und zudem sehr fehleranfällig. Erschwerend kommt hinzu, dass in der Regel die Medikamente nicht auf Wechselwirkungen überprüft werden. In bis zu 50 Prozent der Fälle nimmt der ältere Mensch seine Medikamente falsch ein oder vergisst Einnahmen komplett. Die Folgen sind dramatisch: Laut Zahlen der ARD-Sendung „Panorama“ sterben jährlich 25.000 Menschen, rund eine Million Menschen werden wegen der Falsch- oder Nichteinnahme von Medikamenten pro Jahr in Krankenhäuser eingeliefert – und die Hälfte davon schwebt in akuter Lebensgefahr. Sie haben schädliche, falsche, zu viele Medikamente eingenommen – oder ihre Einnahmen schlichtweg vergessen. All das gibt aber nicht das tatsächliche menschliche Leid wirklich wieder, das Polymedikation auslösen kann.
Nicht zuletzt deshalb wird deutlich, dass in Anbetracht der geschilderten Problematik nur eine digitale Prozesslösung Vorteile bringen kann, die alle Beteiligten einschließt. Direkt eingeschlossen werden sollten insbesondere der Patient, die Angehörigen (gerade bei Senioren), der Apotheker, die Ärzte und die Pflegedienste. Dabei muss das Augenmerk aber gerade auch auf den Krankenkassen liegen, denn sie tragen hohe und weiter steigende Kosten. Neben den Medikamentenkosten verursachen falsch oder gar nicht eingenommene Medikamente zusammen mit unerwünschten Wechselwirkungen jährliche Kosten von rund elf Milliarden Euro. Jedes Jahr landen außerdem Medikamente im Wert von fünf bis sieben Milliarden Euro im Mülleimer. Des Weiteren resultiert jede dritte Krankenhauseinlieferung eines Seniors aus Medikationsproblemen bzw. unerwünschten Wechselwirkungen.
Doch wer ist nun geeignet, die gesamte Steuerung bzw. das Medikamentenmanagement zentral für den Patienten zu übernehmen? Die Lösung ist eigentlich einfach und die Antwort lautet: die Apotheke. Sie hat nämlich das pharmakologische und pharmazeutische Fachwissen und oftmals haben die Apotheker auch zusätzlich eine Weiterbildung im Bereich Medikationsanalyse.
Apotheken kommt eine entscheidende Rolle zu
Ein digitales Medikamentenmanagement- und -ausgabesystem für zuhause ist geeignet, um den beschriebenen Prozess zu vereinfachen und Risiken bei der Einnahme zu minimieren.
Im Mittelpunkt sollte dabei eine Vor-Ort Apotheke stehen, die für den Patienten das gesamte Medikamentenmanagement übernimmt – angefangen von der Prüfung der Rezepte und Medikamente bis hin zur Überprüfung der Wechselwirkungen. Jederzeit kann die Apotheke auch Rücksprache mit einem Arzt nehmen. Das Ergebnis sollte dann ein fachlich erstellter Gesamtmedikationsplan sein.
Durch digitale Lösungen entfällt das fehleranfällige wöchentliche händische Vorrichten der Medikamente und es kann stattdessen automatisiert mittels Schlauchblister für sieben bis 14 Tage erfolgen. Der vom Apotheker erstellte Gesamtmedikationsplan kann im nächsten Schritt digital und automatisch in eine Cloud wandern und von dort direkt in einen kleinen intelligenten Medikamentenspender, der zuhause beim Patienten steht. Dieser meldet sich akustisch und optisch, wenn eine Einnahme ansteht. Sollte der Patient keine Entnahme durchführen, können die Angehörigen, der Pflegedienst oder der Notdienst automatisch per App oder SMS informiert werden.
Durch den digitalen Ablauf kann der jeweilige Hausarzt sicher sein, dass seine Patienten richtig versorgt sind und die Einnahme überwacht wird. Auch die Pflegedienste und pflegende Angehörige werden durch digitale Gesundheitslösungen entlastet. So hat das händische Vorrichten von Medikamenten laut Studien eine Fehlerrate von sieben Prozent. Eine Maschine erledigt das Vorrichten dagegen fehlerfrei und spart kostbare Personalressourcen. Auch das mehrmalige Anfahren von Patienten zur Kontrolle der Medikamenteneinnahme muss nicht durch die knappe Ressource Mensch erfolgen.
Abläufe werden deutlich vereinfacht und sicherer
Für die Krankenkassen ergibt sich überdies ein erkennbares Einsparvolumen.
Aus mehreren Studien ist bekannt, dass die Medikamenten-Adhärenz bei technischer Unterstützung bei bis zu 96 Prozent liegt. Auch das bisherige zeitintensive Rezepthandling entfällt durch digitale Prozesse. Im Normalfall ohne digitale Unterstützung müssen der Patient, oder oftmals die Angehörigen, genau im Blick haben, wann ein Medikament zu Ende geht. Es muss dann der jeweilige Arzt aufgesucht werden, ein Folgerezept erstellt werden lassen, anschließend erfolgt der Gang zur Apotheke, von der der Patient oder die Angehörigen im Idealfall zeitnah das gewünschte Medikament erhalten. Sollte es – was häufig vorkommt – nicht vorrätig sein, ist ein erneuter Apothekenbesuch notwendig.
Durch digitale Medikamentenmanagement- und Vergabe-Lösungen für zuhause lässt sich ein weiteres ernstes Problem lösen. Denn in ländlichen Regionen gibt es immer weniger Ärzte und Apotheken, die weißen Flecken nehmen zu. Nutzt der Senior eine digitale Lösung, kann die betreuende Apotheke auch weiter weg liegen. Die in einer Blisterrolle vorsortierten Medikamente können durch die Post zugestellt werden.
Ein wichtiges Augenmerk bei der Entwicklung solcher digitalen Lösungen muss auf der ultraleichten Bedienbarkeit, auch für ältere Senioren, liegen. Selbst das Einlegen der neuen Medikamenten-Blisterrolle sollte so leicht sein, dass es der Senior selbst kann. Fachpersonal oder Pflegedienste wären daher nicht notwendig. Sollte die Motorik nicht mehr gegeben sein oder der Pflegebedürftige an stärkerer Demenz leiden, könnte das Einlegen der Medikamenten-Blisterrolle immer noch durch Angehörige oder den Pflegedienst erfolgen.
Weiterentwicklung zum Gesundheitshub des Menschen
Denkt man digitale Lösungen wie die beschriebene weiter, sollten sie sich zu intelligenten Gesundheitshubs in der Wohnung des Menschen entwickeln. Ob Videotelefonie oder Sprechstunde, direkte Kommunikation mit der Apotheke, die Einbindung kleiner medizinischer Wearables wie Blutdruck, Gewicht, Zucker und vieles mehr: digitale Lösungen können auf vielfältige Weise dem Erhalt der Gesundheit dienlich sein. So können etwa Vitaldaten automatisch übernommen und auch geprüft werden. Zudem könnte der Gesundheitshub seinen Nutzer auch frühzeitig auf mögliche gesundheitliche Gefahren hinweisen.
Nicht zu unterschätzen ist auch das automatisch generierte Datenvolumen von digitalen Gesundheitslösungen. Die pseudonymisierten Daten bilden eine wichtige Voraussetzung für die zukunftsweisende medizinische Forschung. Wichtig ist dabei, dass alle Daten dem Patienten gehören und er allein darüber entscheiden kann, wer Einblick bekommt.
Außer dem behandelnden Arzt, dem Krankenhaus oder dem Pflegedienst braucht niemand Zugriff auf seine persönlichen Medikationsdaten bekommen. Neben der Verschlüsselung der Daten bedeutet das auch ein gravierendes Plus an Datensicherheit.
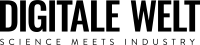


Um einen Kommentar zu hinterlassen müssen sie Autor sein, oder mit Ihrem LinkedIn Account eingeloggt sein.