Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften und Handeln wird für Unternehmen durch gesetzliche Vorgaben zunehmend real: Was 2017 mit der CSR-Berichtspflicht für kapitalmarktorientierte Unternehmen, Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen in Deutschland begann, findet seine Fortführung im ESG-Reporting (Environmental-Social-Governance) für größere Unternehmen, das 2025 auf rund 15.000 mittelständische Unternehmen ausgeweitet wird. Doch was bedeutet das? Was muss bzw. soll eigentlich berichtet werden? ESG steht für die Bereiche Umwelt (Environment), Soziales und Unternehmenssteuerung (Governance), für die jeweils Kennzahlen definiert und berichtet werden müssen. Dabei verlangen die Reportingpflichten nicht nur eine Beschäftigung mit den selbst verursachten Treibhausgasemissionen, sondern zusätzlich auch eine Betrachtung der gesamten Lieferketten, also auch die unmittelbaren und mittelbaren Zulieferer der Unternehmen. Aufgrund dieser umfänglichen Herangehensweise stehen Firmen nicht nur vor der fachlichen Herausforderung, was zu berichten ist, sondern auch vor einer großen technischen Aufgabe: Wie können alle Daten effizient gesammelt, analysiert, in Relation zu einer betrachtet und nachvollziehbar reportet werden?
Liegen die notwendigen Daten im Unternehmen vor, bieten sich zwei technische Ansätze als Lösung an: ein Bottom-Up-Ansatz versus ein Top-Down-Ansatz. Während der erste Ansatz das Produkt bzw. die Produktion als Basis sieht und darauf mit Messungen und Berechnungen aufbaut, geht der zweite Ansatz von einer aggregierten Sicht basierend auf Finanzdaten aus, aus der die produktspezifischen Kennzahlen über Schlüssel abgeleitet werden.
Will man beide Ansätze verstehen, hilft ein Beispiel: Um seiner Berichtspflicht nachzukommen, möchte ein Unternehmen herausfinden, wie viel CO2 in seinem Produkt steckt, und in Erfahrung bringen, wie groß der spezifische CO2-Fußabdruck seiner Produkte ist. Was ist dafür zu tun?
Der Bottom-Up-Ansatz
Um den größten Teil des CO2-Fußabdrucks zu erfassen, werden zwei Teilbereiche betrachtet:
1. die Ermittlung der Energieeffizienz je Produkt
2. der CO2-Eintrag aus dem Rohmaterial
Fangen wir mit der Ermittlung der Energieeffizienz an: Im ersten Schritt müssen die relevanten Quellen angebunden und dem BW bereitgestellt werden. Dies kann zum einen virtuell (also ohne physische Kopie) oder als Persistenzschicht im BW erfolgen. Mit diesen Daten lassen sich in einfachen Schritten erste Analysen für einen Einblick in den Stromverbrauch und in die Produktionsperformance erstellen. Im ersten Schritt müssen die vorliegenden Zählerstände in Energieverbräuche in den zu untersuchenden Zeiträumen umgerechnet werden. Im zweiten Schritt können dann über die Stammdaten der Anlagen die Energieverbräuche einzelnen Maschinen direkt zugeordnet werden, was eine schnelle Übersicht darüber bringt, welchen Anteil einzelne Arbeitsplätze am Stromverbrauch haben. Die Auftragsdaten liefern direkt einen Einblick in die Produktionsleistung eines Werks, wodurch sich die produzierten Stückzahlen und die Teilequalität auswerten lassen. Nebenbei kann so die Produktionsgeschwindigkeit jeder Maschine beurteilt werden.
Zur Überleitung vom Energieverbrauch zur Energieeffizienz müssen die Energiedaten mit den Auftragsdaten verknüpft werden. Dabei ordnet man zunächst die Informationen über den Energieverbrauch wie oben beschrieben den Arbeitsplätzen zu. Über die Daten der Aufträge (Auftragsbeginn / Auftragsende) kann dann der Energieverbrauch für jeden Auftrag und damit prinzipiell pro Teil berechnet werden. Legt man nun den Strommix des Energieversorgers zu Grunde, ist damit der erste Teil der Ausgangsfrage „wie viel CO2 steckt in unserem Produkt“ geklärt.
Ganz nebenbei lässt sich an dieser Stelle auch Optimierungspotenzial erkennen, denn mit den vorliegenden Daten können direkt Energieeffizienzstudien durchgeführt werden, die mögliches Energiekosten-Einsparpotenzial aufzeigen: Werden mehrere gleichartige Maschinen zur Produktion genutzt, können die Produkte vor dem Hintergrund der Energieeffizienz auf diese verteilt werden, sodass die Energienutzung und damit die Kosten pro Teil gesenkt werden können.
Kommen wir zum zweiten Teilbereich des CO2-Fußabdrucks: der CO2-Eintrag aus dem Rohmaterial. Grundlage für diese Bestimmung sind die Daten aus den Rohmaterialien, die zu Beginn bei den Lieferanten abgefragt werden müssen. Liegen diese vor, können die drei notwendigen Informationen extrahiert werden: Erstens muss anhand der Stücklisten bestimmt werden, welche Rohmaterialien im fertigen Produkt enthalten sind. Bei mehrstufigen Prozessen muss man hier so weit zurückgehen, dass alle verwendeten Rohmaterialien (inkl. der Zwischenprodukte) ermittelt sind. Zweitens muss für jedes verwendete Material die eingesetzte Menge bestimmt werden. Und drittens muss der Energieverbrauch für die Produktion von Zwischenprodukten diesen zugeschlagen und als Eintrag aus Rohmaterial für das fertige Produkt verarbeitet werden. Werden am Ende all diese Informationen mit den Daten der Fertigungsaufträge verknüpft, kann der CO2-Eintrag aus Rohmaterial für jeden Fertigungsauftrag und damit für jedes Teil bestimmt werden.
Um zum Schluss zum Endergebnis des Bottom-Up-Ansatzes zu gelangen, muss nun noch die Summe aus den CO2-Emissionen des Energieverbrauches und den CO2-Anteilen des Rohmaterials gebildet werden, dann erhält man den CO2-Fußabdruck der fertigen Produkte.
Der Top-Down-Ansatz
Wie gezeigt, bietet der Bottom-Up-Ansatz schon im Aufbau viele Einblicke in den Prozess, ist aber aufgrund des hohen Detailgrades der Daten sowie der hohen Anforderungen an die Infrastruktur sehr komplex, da jedes lokale System an das BW angebunden werden muss. Alternativ kann ein Top-Down-Ansatz, der die Produkte anhand von relativen „Äquivalenzeinheiten“ (Equivalence Units, EQU) bewertet und so die Verteilung von Energieverbräuchen und CO2-Emissionen analog zur Verteilung von Gemeinkosten ermöglicht. Vorausgesetzt wird dabei, dass die Standardpreise (Herstellkosten) und die durchschnittlichen Verkaufspreise je Produkt bekannt sind. So kann mit der Bestimmung der produzierten Menge angefangen werden. Da die in einem Betrachtungszeitraum gefertigte Menge eines Produktes nicht zwingend mit dem Umsatz korreliert, sondern gegebenenfalls auch Bestandsänderungen erfolgen, ist die Information über die gefertigten Mengen nur in der Kombination aus Umsätzen, Bestandswertveränderung und Ausschusskosten enthalten.
Um die Äquivalenzeinheiten für den Energieverbrauch zu bestimmen, bieten sich kurzzeitige Messungen an den einzelnen Arbeitsplätzen oder Maschinen an. In der Regel sind die notwendigen Daten in größeren Betrieben bereits erfasst worden (z.B. im Rahmen einer Energiemanagement-Zertifizierung nach ISO 50.001). In kleineren Betrieben kann man die Daten mit mobilen Messgeräten im Rahmen von Kurzzeitmessungen erfassen.
Sin die Äquivalenzeinheiten für jedes Produkt bekannt, kann der Gesamtenergieverbrauch (und damit der CO2 Anteil) Anhand der Produzierten Mengen und Äquivalenzeinheiten den einzelnen Produkten zugeordnet werden.
Der CO2 Anteil aus dem Rohmaterial kann analog zum Bottom-Up-Ansatz aus den Stücklisten und den Informationen der Zulieferer bestimmt werden.
Fazit
Der Bottom-Up Ansatz liefert neben der exakten Antwort auf die Ausgangsfrage automatisch tiefgreifende Analysemöglichkeiten der operativen Daten eines Unternehmens. Der Preis dafür ist eine hohe Komplexität in der technischen Infrastruktur (Vernetzung lokaler Systeme) und in der Modellierung der Daten.
Der Top-Down Ansatz reduziert diese Komplexität deutlich und vereinfacht das Reporting. Dafür sind die Analysemöglichkeiten eingeschränkter. Die Ausgangsfrage kann zwar nur mit einer Annäherung an die tatsächlichen Werte beantwortet werden, unsere Studien zeigen aber, dass bei richtiger Wahl der Äquivalenzeinheiten nur sehr geringe Abweichungen auftreten, sodass die Ergebnisse beider Ansätze bezogen auf die Ausgangsfrage als äquivalent angesehen werden können.
Letzten Endes hängt es vom Einsatzzweck ab, welche Methode besser zu einem Unternehmen passt: Möchte man mit einem schlanken System einfach nur die Anforderungen an ein ESG-Reporting erfüllen, ist der Top-Down-Ansatz der richtige Weg, um schnell Berichte zu generieren und diese in das vorhandene Berichtswesen des Unternehmens zu integrieren. Durch die Nähe zu den Finanzdaten eignet sich dieser Ansatz auch für die Integration in das Finanz-Reporting. Ist man dagegen im Bereich operatives Reporting (Stichwort Industrie 4.0) schon weiter, will eine höhere Genauigkeit oder möchte hier ohnehin Optimierungen durchführen, kann sich der Bottom-Up-Ansatz durch potenzielle Einsparungen schnell auszahlen.
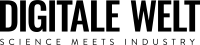


Um einen Kommentar zu hinterlassen müssen sie Autor sein, oder mit Ihrem LinkedIn Account eingeloggt sein.